

 
|
Distributed Systems Group |
Schon aus der kurzen Geschichte der Informatik ist ablesbar, dass es die Ideen waren, die die grossen Veränderungen hervorgerufen haben, und nicht die schnellen "Hacks". Ein neues Verständnis und Selbstverständnis des Informatikers tritt zutage: Nicht mehr der Experten-Held, der dem Enduser-Laien zeigt, wie Informatik richtig funktioniert, ist gesucht. Sondern der Diener, der freiwillig auf die Rolle im Mittelpunkt verzichtet und in den Hintergrund tritt.
Weiters sollen auch hinreichend klare und deutliche Begriffe vermittelt werden, was aber nicht eine Präzision im mathematischen Sinne bedeuten kann. Schliesslich soll eine Uebersicht über das Spektrum der aktuellen Entwicklung gegeben werden.
Weiterführende Informationen und Quellen sind den Handouts zum Vortrag (Fotokopien der Folien) und der Uebersichts-Web-Page
https://www.inf.ethz.ch/department/IS/vs/education/SS2000/UC/zu entnehmen.
Ubiquitous im aktuellen Computer-Jargon hat eine analoge Bedeutung, erhebt auch den Anspruch, kein Modewort zu sein. Es geht um eine Vision der Zukunft der Informatik, aber auch der Gesellschaft und des Lebens im allgemeinsten Sinn. IT soll etwas für jeden Menschen einfach Einsetzbares und Nützliches werden. Dies wird erreicht, wenn IT als IT aus dem Bewusstsein des Anwenders hinter dem Zweck der Anwendung verschwindet.
Wer mit dem Hammer einen Nagel einschlägt, denkt im Normalfall nicht an den Hammer, sondern z.B. an das Haus, das er bauen will. Beim Computer ist dieser Prozess des "Normal-Werdens" noch lange nicht ausgereift. Seine universale Einsetzbarkeit lässt im Gegenteil viele Möglichkeiten offen und verlangt spezielle Kenntnisse für den Einsatz zwecks einer konkreten Absicht.
Auch für den oberflächlichen Kenner des aktuellen Standes der IT erscheint die Vision des Verschwindens der IT als IT in mancherlei Hinsicht als technisch realisierbar, also kein reines Phantasieprodukt. Es ist daher mit Gellersen (Hans-W. Gellersen: Ubiquitäre Informations-technologien, Aufsatz erhältlich über Internet) eine Begriffsbestimmung möglich. Diese hat aber keine allgemein-verbindliche Autorität, sondern kann bloss mehr oder weniger plausibel sein.
Es werden mit ubiquitär hauptsächlich folgende beiden Gegenstände bezeichnet:
Bedeutung 1 trifft die Vision nur bedingt, da General Purpose-Computer weiter im Mittelpunkt stehen. Diese verschmelzen zwar verschiedenste Services (vgl. ISDN), aber sie selber verschmelzen nicht mit der Anwendung (appliance). Zudem braucht es spezialisiertes Wissen zur Beherrschung solcher Maschinen.
Bedeutung 2 rückt die technologischen Aspekte an der IT für den Anwender in den Hintergrund, nicht aber die IT-Unterstützung und Vorteile (information appliance). Erwünscht ist also nicht mehr ein spezielles eigenständiges IT-Gerät wie ein PC, sondern Geräte, die sich möglichst unauffällig in natürliche Abläufe einbetten lassen und gegebenenfalls miteinander verbunden sind, wie beispielsweise der "MediaCup", wo eine Kaffeetasse per Sensor-, Prozess- und Kommunikations-funktion automatisch Zustände erkennt und weiterleitet.
Die Verallgemeinerung von Bedeutung 1 führt zu "persönlicher IT", die sich überall mitnehmen lässt. Diejenige von Bedeutung 2 zu sog. " Informationsumgebungen", die überall vorhanden sind.
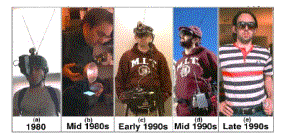
Bush schrieb seinen berühmten Artikel am Ende des 2. Weltkrieges als höchster wissenschaftlicher Beamter in der US-Administration und als Chef von 6000 Forschern, die sich während des Krieges für die Ueberlegenheit der US-Technologie einsetzten und die ja in der Atombombe gipfelte. Er stellte sich folgende Hauptfrage: Wie kann Wissen erlangt, verarbeitet und weitergegeben werden? Denn niemand kann mehr alles wissen, Spezialisierung ist notwendig. Bushs Antwort war: Es braucht neue Methoden im Umgang mit Wissen. Die Technologien dazu sind im Unterschied zu früher alle vorhanden und bezahlbar: Sie stammen aus der Photographie, Kommunikation, TV, Microfilm etc.
Die Encyclopedia Britannica kann auf das Volumen einer Zündholzschachtel reduziert werden. Das kumulierte menschliche Wissen ist darin versammelt. Aber obwohl dieses in jeder besseren Bibliothek vorhanden ist, wird es nur von wenigen konsultiert. Das eigentliche Ziel muss es also sein, das Wissen ubiquitär und den Zugriff mechanisierbar zu machen.
Natürliche Sprache ist wenig geeignet für Mechanisierung. Auch kann menschliches Denken nicht durch Mechanik ersetzt werden. Aber die Zeit, die der Wissenschaftler zur Sammlung seiner Rohdaten verbraucht, kann reduziert werden. Hierin sieht Bush eine Hauptentlastung des Wissenschaftlers. Lochkarten können arithmetisch-numerische und symbolisch-logische Operationen steuern. So können die erforderlichen Operationen des Speicherns, Aenderns, Löschens, Findens etc. maschinell durchgeführt werden.
Bis hierhin scheinen Bushs Ueberlegungen nue ein sachlich fundiertes Konzept für die Herstellung eines Computers zu sein. Für sich allein schon bemerkenswert. Denn zu dieser Zeit hatten ja Mauchly und Zuse kaum ihre ersten funktionstüchtigen "Rechner-Computer" erfunden. Es folgt aber noch ein nächster Schritt: Memex. Klar unterscheidet Bush die Arbeitsweise der Selektion von Daten ueber einen (sortierten) Index und der assoziativen Methode beim Menschen, dessen Gedächtnis eben nicht dauerhaft ist. Die Maschine Memex ("Gedächtniserweiterung") soll dem Menschen helfen, in einer Art Hypertextsystem seine individuellen Assoziationen zwischen Wissensrepräsentationen abzulegen, und sich so dem menschlichen Gedächtnis anzunähern.
Die Methode der Voraussagen von Bush ist nicht ein kartesischer Zweifel, sondern "Prophecy based on extension of the known ...". Bush geht auch noch über Information-Retrieval- und Hypertext-Systeme hinaus: Er denkt daran, den Dateninput, den die Sinne an das Gehirn liefern, zu nutzen. Er nimmt dabei Bezug auf die Uebermittlung von akustischen Daten über Knochen bei Schwerhörigen. Als Vollendung eine Art "Brain-Interface", wie dies in jeder besseren Science-Fiction-Literatur vorkommt.
Dank dem Sputnikschock wurde die US-Forschungskultur revolutioniert. ARPA wurde gegründet, man wollte die technologische Ueberlegenheit der USA durch neuartige und risikoreiche Projekte herbeiführen. Lickliders Ideen eines interaktiven Computers mit Keyboard und Graphikdisplay führten dazu, dass Licklider 1962 Direktor des "IT Offices" im Pentagon wurde. Licklider war eine besondere Art von Forschungmanager, der den Computer als kulturelle Errungenschaft betrachtete und diese universal und der ganzen Gesellschaft zur Verfügung stellen wollte.
Einige Jahre nach Ende des 2. WK zurück in Californien hatte Engelbart die Einsicht, dass er sein Leben in den Dienst der Menschheit einsetzen musste. Die globalen Probleme brauchten zu ihrer Lösung neue Werkzeuge. "If you can improve our capacity to deal with complicated problems, you've made a significant impact on helping humankind. That was the kind of payoff I wanted, so that's what I set out to do.
Englebart hatte persönlich und beruflich keine einfache Biographie mit vielen Widerständen und Rückschlägen für seine Ideen, da diese über die zeitgemässen Vorstellungen von batch-Verarbeitung von numerischen Problemen weit hinausgingen ("amplifier of the mind"). Er führte zunächst an der Universität von Stanford in Californien ein Schattendasein. Dann kam es zu einem unverhofften Wechsel durch die Aenderung in der Regierungsforschungspolitik, die durch den Sputnik-Schock ausgelöst und vorhin beschrieben wurde. Engelbart verfasste ein Grundsatzpapier, worin er seine Philosophie beschrieb: Sein Problem war das menschliche Verstehen (" comprehension") , das er durch Hilfsmittel, Werkzeuge schneller, tiefer, besser gestalten, aber nicht etwa ersetzen wollte. "Human intellect uses tools, but the power of the human mind is not itself limited to the tools the human brain automatically provides".
Engelbart erhielt aufgrund seiner Ideen beträchtliche Forschungsgelder vom Verteidigungsministerium und konnte damit seine Visionen anpacken. Er gründete das Augmentation Research Center (ARC). Das erste Entwicklungsziel war das sog. NLS, das für "on line system" steht.
Am 9.12.1968 führte Engelbart NLS an einer legendären Konferenz in San Francisco der Computerforschergemeinschaft vor. Es hatte eine Art Maus, ein GUI mit Windows etc. Der Erfolg war überwältigend, vor allem auch deswegen, weil er über seine Entwicklungen nicht einfach sprach, sondern sie selber vorführte. Mit dieser Demo hatte Engelbart gezeigt, dass Computer nicht einfach nur rechnen können, sondern sie auch zur Bearbeitung von Dokumenten, Texten verwendet werden können. Er führte auch eine Art Electronic Mail vor und befasste sich mit Teleconferencing.
Der durchschlagende Erfolg war aber auch der Anfang vom Ende von ARC. Es kam zu diversen Problemen. Es war nicht mehr möglich, das Tempo und die Intensität der weiteren Forschung beizubehalten. 1975 wurde das ARC an eine Privatfirma verkauft.
Parallel dazu kam es aber zu zwei anderen wichtigen Entwicklungen: Der Personal Computer wurde technisch und ökonomisch möglich und Xerox gründete in der Nähe vom ARC-Sitz das Palo Alto Research Center PARC, das in den 70er Jahren mit dem Computer namens Alto die Vorläufer von Mac, PC etc. mit der zugehörigen Software baute, aber nicht in ein kommerziell erfolgreiches Produkt umsetzen konnte.
Aus der menschlichen Psychologie ist bekannt, dass eine genügend beherrschte Fertigkeit aus dem Zentrum des Bewusstseins verschwindet. Nicht mehr die Schriftbeherrschung steht im Zentrum, sondern die von ihr transportierten Bedeutungsgehalte.
Weiser grenzt ubiquitous computing von zwei anderen aktuellen Tendenzen ab: Ein tragbarer Superlaptop wäre in der analogen Welt der Schrift, das Herumtragen eines einzigen besonders wichtig scheinenden Buches. Virtual Reality ist kein ubiquitous computing, weil es beschrieben in einer geografischen Metaphorik nur eine Landkarte, aber kein Territorium selber ist. Die Anwender wollen eigentlich nur alltägliche Vorgänge schlau, aber ohne spezielles eigenes Nachdenken erledigen lassen. Weiser sieht darin folgende zwei Hauptproblembereiche: die Grösse der Geräte und ihre Lokalisierung.
Weiser schlägt folgende drei Grössenordnungen für Geräte vor, inch- (tab) , foot- (pad) und yard-scale (board). Also ganz kleine von der Grösse einer Zündholzschachtel, eines Palm oder einer Wandtafel. Anstatt eine Applikation wie unter Windows in ein Icon zu minimieren, soll man dies auf einen tab tun, den man überallhin mitnehmen kann und den man am gewünschten Ort wieder zur ursprünglichen Umfang der Applikation maximieren kann.

Bild: Xerox ParcTab als Beispiel für ein Tab
Pads sind eine Art scrap computer (wie sog. "Sudelpapier"), sie sind nicht individualisiert wie der uns bekannte PC. Davon unterscheiden sie sich ganz fundamental darin, dass sie keine Desktop-Metapher repräsentieren, sondern in den realen Desktop (oder andere Orte) unseres Arbeitsplatzes integriert sind. Man gebraucht sie wie heute Papier.
Boards dienen vor allem der Gruppenkommunikation, Gruppenarbeit. Die wirkliche Neuerung und das Potential dieser Geräte stammt aber nicht aus einem dieser Geräte selber, sondern aus der Interaktion, dem Zusammenspiel von allen. Verlegte Papiere können gesucht werden, die Modalität der Kommunikation kann vom Benutzer mitbestimmt werden (z.B. Lautstärke etc.).
Weiser nimmt auch Stellung zu den ganz konkreten Entwicklungsproblemen solcher Geräte zur Zeit der Abfassung seines Aufsatzes: Hardware (Leistung, Preis, etc.), Betriebssysteme (Verteilung, Dynamik, Architektur etc.), Netzwerk (Kapazitäten, Protokolle etc.). Es gibt aber keine ernsthaften prinzipiellen Verhinderungsgründe.
Schliesslich erzählt Weiser in einem kurzen Beispiel, wie sich ubiquitous computing im ganz normalen Leben abspielen könnte. Im privaten Alltag mit stimmengesteuerten Haushaltsmaschinen, in Fenstern ablesbaren Informationsflüssen, wie Kommunikation mit Nachbarn, Ueberwachung von Kindern. Bedienungsanleitungen von Geräten werden als Tabs geliefert. Verkehrsmeldungen und Parkplatzsuche interaktiv ins Auto übermittelt.
Im Geschäft arbeitet man mit Kollegen mit einem sog. Virtual Office Sharing, gegenseitig geteilten Zugangsberechtigungen auf den Programmen/ Dokumenten. Kommunikation über grössere Distanzen sind sowieso schon ganz normal und man kann sich nach Bedarf in Telekonferenzen ein- und ausklinken.
Nicht zuletzt weist Weiser auch auf die Problematik des Datenschutzes hin, der durch Staat, Gesellschaft, Privatfirmen, Vorgesetzten hintertrieben werden kann. Er schlägt als Gegenmassnahme die Einführung von digitalen Pseudonymen vor.
Alles in allem soll sich der Computer in den Hintergrund der menschlichen Lebenswelt verziehen, was zu einer Verminderung der Zahl der " Computer-Addicts" führen soll. Vor allem aber soll ubiquitous computing auch dazu beitragen dem Informationsüberfluss Herr zu werden, aber auch zu einem neuen Regenerationsmittel für die Menschheit werden.
Hinweis auf zusammenfassende Sekundärliteratur, die diese Themen weiter ausführt:
Howard Reinhold: Tools for Thought, 1985, auf dem Web erhältlich, Neuauflage April 2000 bei MIT Press vorgesehen
In seiner ursprünglichen Form versandte der aktive Badge alle 15 Sekunden seinen Code an die Sensoren. Die daraus abgeleiteten Lokalitäteninformation war über das WWW abrufbar.
| Nr | Ort | Projektnamen und Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | MIT |
|
| 2 | Georgia Tech |
|
| 3 | CSTAR/ Andersen Consulting |
|
| 4 | Microsoft Research |
|
| 5 | Teco/ Uni Karlsruhe |
|
| 6 | Interactive Insitute/ PLAY |
|
| 7 | Uni Lancaster |
|